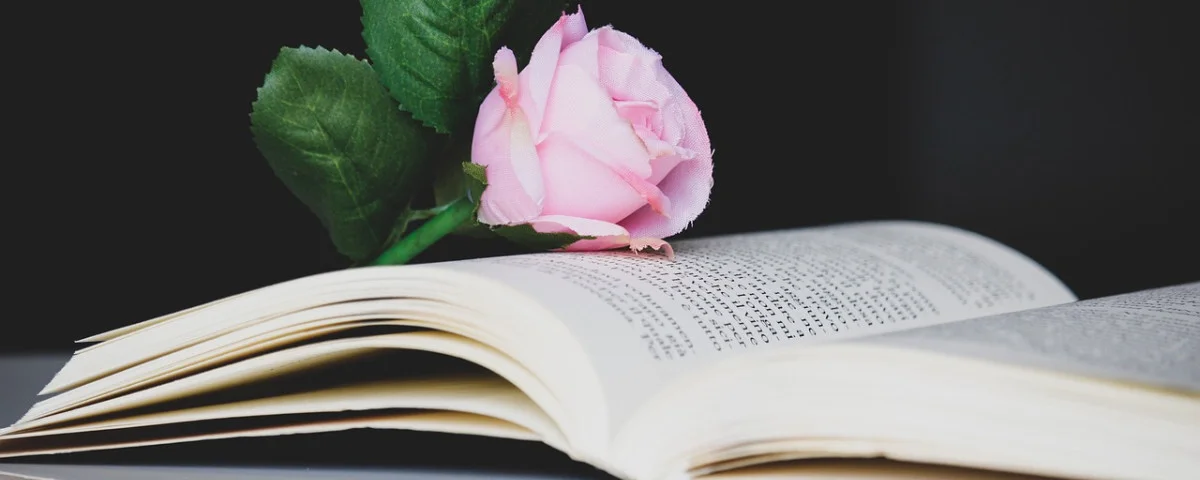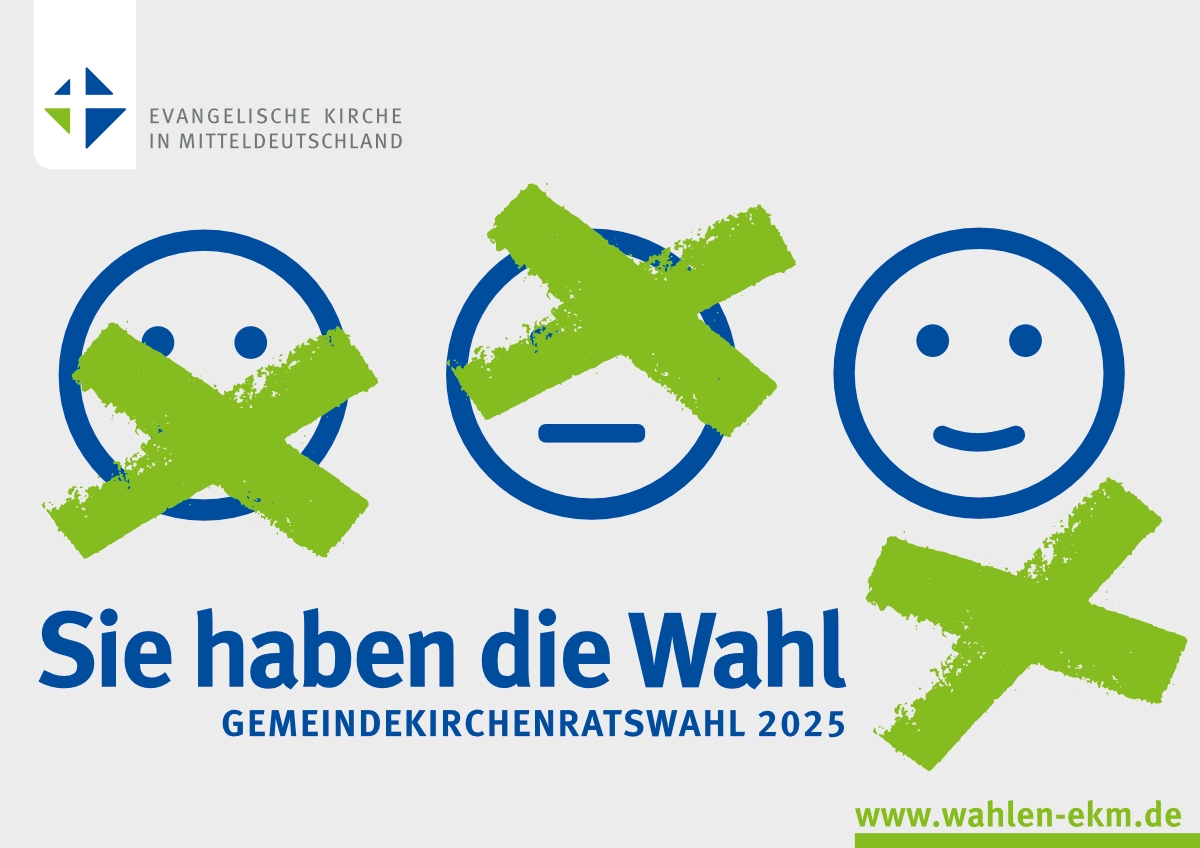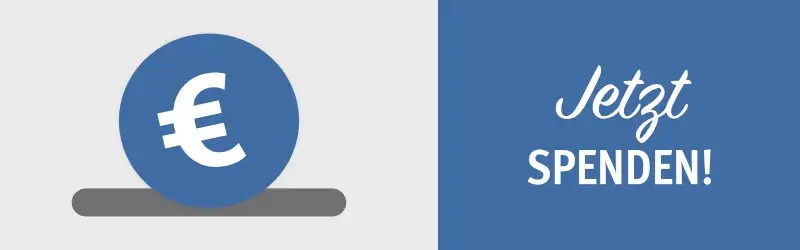Auf dem rechten Weg
„Zeige mir, HERR, den Weg deiner Gebote, dass ich ihn bewahre bis ans Ende“ (Ps 119,33). Dieses Gebet des Psalmbeters zeigt ein tiefes Verlangen: auf dem rechten Weg bleiben zu können. Auch wir kennen die Erfahrung, inmitten von Unsicherheit Orientierung zu suchen.
Die Bibel macht deutlich, dass dieser Weg nicht von uns selbst gefunden wird, sondern dass Gott ihn eröffnet. Im Buch Exodus lesen wir vom Passahfest (Ex 12,1–14): Israel wurde in der Nacht des Gerichts durch das Blut des Lammes bewahrt. Augustinus deutet: Wie die Türpfosten mit Blut bestrichen waren, so sind unsere Herzen durch das Blut Christi gezeichnet. Nur wer unter diesem Zeichen steht, bleibt bewahrt. Damit ist klar: Der rechte Weg beginnt mit der Vergebung durch Jesus Christus, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt (Joh 1,29).
Von hier aus entfaltet Paulus in Römer 13,8–14, wie dieser Weg praktisch aussieht. Es ist der Weg der Liebe: „Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes“ (Röm 13,10). Wer Christus angezogen hat, legt die Werke der Finsternis ab – Egoismus, Streit, Gleichgültigkeit – und lebt im Licht der Liebe. Chrysostomus erinnert: Liebe ist keine Option, sondern das Band, das den ganzen Leib zusammenhält.
Doch Liebe zeigt sich nicht nur im Positiven, sondern auch darin, wie wir mit Schuld und Versagen umgehen. In Matthäus 18,15–20 ruft Jesus dazu auf, einander zu korrigieren – nicht um zu strafen, sondern um zu gewinnen. Chrysostomus schreibt: „Er spricht nicht: Strafe ihn, sondern: gewinne ihn.“ Der rechte Weg ist also ein gemeinsamer Weg. Wir tragen einander, wir rufen zurück, wenn einer abirrt, und wir suchen die Versöhnung.
So entsteht ein roter Faden: Durch das Blut Christi sind wir befreit, durch die Liebe Christi sind wir geleitet, durch die Gemeinschaft in Christus sind wir bewahrt. In einer Welt voller Unsicherheit schenkt das Evangelium eine klare Richtung: Der Weg ist Christus selbst (Joh 14,6). Wer Ihm vertraut, findet Vergebung, Hoffnung und Kraft zur Liebe.
Möge Gott uns helfen, diesen Weg zu gehen – dankbar, gehorsam und voller Liebe. Denn nur so erreichen wir das Ziel: die ewige Gemeinschaft mit Ihm.
Wort zum Sonntag: Auf dem rechten Weg
„Zeige mir, HERR, den Weg deiner Gebote, dass ich ihn bewahre bis ans Ende“ (Ps 119,33). Dieses Gebet des Psalmbeters zeigt ein tiefes Verlangen: auf dem rechten Weg bleiben zu können. Auch wir kennen die Erfahrung, inmitten von Unsicherheit Orientierung zu suchen.
Die Bibel macht deutlich, dass dieser Weg nicht von uns selbst gefunden wird, sondern dass Gott ihn eröffnet. Im Buch Exodus lesen wir vom Passahfest (Ex 12,1–14): Israel wurde in der Nacht des Gerichts durch das Blut des Lammes bewahrt. Augustinus deutet: Wie die Türpfosten mit Blut bestrichen waren, so sind unsere Herzen durch das Blut Christi gezeichnet. Nur wer unter diesem Zeichen steht, bleibt bewahrt. Damit ist klar: Der rechte Weg beginnt mit der Vergebung durch Jesus Christus, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt (Joh 1,29).
Von hier aus entfaltet Paulus in Römer 13,8–14, wie dieser Weg praktisch aussieht. Es ist der Weg der Liebe: „Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes“ (Röm 13,10). Wer Christus angezogen hat, legt die Werke der Finsternis ab – Egoismus, Streit, Gleichgültigkeit – und lebt im Licht der Liebe. Chrysostomus erinnert: Liebe ist keine Option, sondern das Band, das den ganzen Leib zusammenhält.
Doch Liebe zeigt sich nicht nur im Positiven, sondern auch darin, wie wir mit Schuld und Versagen umgehen. In Matthäus 18,15–20 ruft Jesus dazu auf, einander zu korrigieren – nicht um zu strafen, sondern um zu gewinnen. Chrysostomus schreibt: „Er spricht nicht: Strafe ihn, sondern: gewinne ihn.“ Der rechte Weg ist also ein gemeinsamer Weg. Wir tragen einander, wir rufen zurück, wenn einer abirrt, und wir suchen die Versöhnung.
So entsteht ein roter Faden: Durch das Blut Christi sind wir befreit, durch die Liebe Christi sind wir geleitet, durch die Gemeinschaft in Christus sind wir bewahrt. In einer Welt voller Unsicherheit schenkt das Evangelium eine klare Richtung: Der Weg ist Christus selbst (Joh 14,6). Wer Ihm vertraut, findet Vergebung, Hoffnung und Kraft zur Liebe.
Möge Gott uns helfen, diesen Weg zu gehen – dankbar, gehorsam und voller Liebe. Denn nur so erreichen wir das Ziel: die ewige Gemeinschaft mit Ihm.
Stefan Beyer
Lutherhaus Jena